Ein Sieg für die Freiheit des Wortes

Es kommt vor, dass ein arabischer Schriftsteller einen Roman schreibt, der dem einen oder anderen Menschen an einflussreicher Stelle nicht gefällt. Wenn dies passiert, bekommt es der Autor mit dem wahren Gesicht der Staatsmacht zu tun – einer hässlichen Fratze, die die breite Masse und die internationale Gemeinschaft für gewöhnlich nicht sieht, weil sie unter einer dicken Schicht von Schminke und Kunsthaar verborgen ist.
Anfang 2002 erschien in Sanaa mein Roman Qawarib Jabaliya ("Gebirgsboote"). Ein paar Verrisse hatte ich als Reaktion durchaus erwartet, aber was mich dann doch überraschte, war, dass Imame zu belesenen Literaturkritikern wurden und mein Roman zum Thema feuriger Moscheepredigten wurde.
Auch das jemenitische Ministerium für Kultur wollte mit von der Partie sein und reichte Strafanzeige gegen mich ein. Ich bekam eine Vorladung zum Staatsanwalt, der Verlag, der meinen Roman herausgebracht hatte, wurde behördlicherseits geschlossen und sein Besitzer ebenfalls zum Verhör bestellt, ebenso wie mehrere meiner Freunde, die man beschuldigte, sie hätten sich der Beihilfe zur Veröffentlichung eines Romans schuldig gemacht.
Ich erhielt Morddrohungen, und bewaffnete Stammeskämpfer umstellten meinen Arbeitsplatz. Gleichzeitig begann in den Zeitungen eine Hetzkampagne gegen mich. Angesichts der Bedrohungen sah ich für mich keinen anderen Ausweg als den Jemen zu verlassen. Dem Schriftstellerverband meines Landes und dem großartigen jemenitischen Gelehrten Ahmad Jaber Afif, der mittlerweile verstorben ist, hatte ich zu verdanken, dass ich den Nachstellungen gegen mich gerade noch entkam.
In Abwesenheit wurde mir im Jemen der Prozess gemacht, dem mein Verleger Abdallatif Abadi und meine mitangeklagten Freunde in einem Käfig beiwohnen mussten. Das Gericht ließ durchblicken, dass mir als Verfasser des Romans fünf Jahre Gefängnis wegen "Verunglimpfung der Armee" drohten.
Am Nullpunkt
Als Exil hatte ich Damaskus gewählt, aber am liebsten wäre ich so schnell wie möglich nach Sanaa zurückgeflogen. Doch die jemenitischen Behörden waren unerbittlich. Bei der Interpol war bereits ein internationaler Haftbefehl gegen mich beantragt. Als krimineller Justizflüchtling sollte ich doch bitte nach Jemen ausgeliefert werden.
Was man als Geflüchteter im Exil psychisch durchmacht, weiß nur, wer es selbst einmal erlebt hat. Es ist anders, als wenn man sich aus freien Stücken dazu entschieden hat, sein Land zu verlassen. Heute kann ich offen eingestehen, dass ich in Syrien mehrfach an Selbstmord gedacht habe, denn ich erlebte dort zum ersten Mal jenen schrecklichen Zustand namens Depression. Es fühlte sich unbeschreiblich bitter an. Ich kam an einen Nullpunkt und wollte nicht mehr weiterleben.
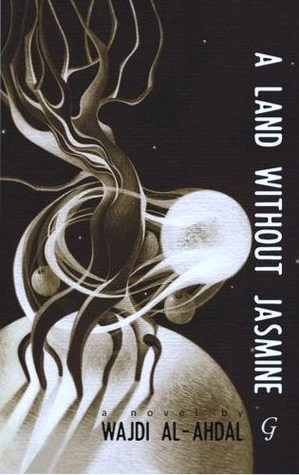
Im Dezember 2002 bekam ich dann einen überraschenden Telefonanruf. Es war eine Nachricht, deren Wahrscheinlichkeit für einen exilierten Autor bei eins zu einer Million liegt: Mein Freund Salih al-Baidhani teilte mir mit, der Nobelpreisträger Günter Grass habe sich für mich eingesetzt und ihm sei zugesichert worden, ich könne in den Jemen zurückkehren, ohne weitere Verfolgung von Justiz und Extremisten befürchten zu müssen.
Es klang so unglaublich, dass ich es im ersten Moment nicht fassen konnte. Ich war völlig benommen. Doch mein Freund beharrte darauf, ich solle doch bitte schleunigst ein Ticket zurück nach Sanaa lösen.
Von Verzweiflung zu Glückseligkeit
Als ich auflegte, war mir schwindlig und ich fühlte mich wie in einem Orkan der höchsten Windstärke. Ich stieg die Treppe zu meinem Zimmer hinauf und musste aufpassen, nicht rückwärts hinunterzufallen. Es war, als hätte mich jemand aus einem tiefen Brunnen emporgeholt und als fielen die Geister von Todesgefahr und Gefangenschaft von mir ab.
Es ist gar nicht so leicht, von einer Minute auf die andere von Verzweiflung hin zu Glückseligkeit zu wechseln. Ich wollte tanzen! Ich wollte auf die Straße laufen und Schreie wie ein Urwaldmensch ausstoßen.
Hunderte von Gedanken rasten mir durch den Kopf, und ich verstand, dass "verrückt" zu sein nichts anderes heißt als übermäßige geistige Aktivität und die Unfähigkeit, ununterbrochene Gedankenströme zu bewältigen. Es dauerte ein paar Stunden, bis ich mich wieder unter Kontrolle hatte und mir meine neue Situation klar machte. Schlaf fand ich dennoch erst nach Sonnenaufgang und dann nur eine Stunde lang. Ich stand auf, kaufte mir Zeitungen und entnahm diesen, dass mein Freund die Wahrheit gesagt hatte.
Günter Grass war kurz zuvor zur Teilnahme an einem literarischen Symposium nach Jemen gekommen. Mit dabei waren dreißig Schriftsteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Schriftsteller aus anderen arabischen Ländern. Und sie wurden anlässlich des Besuchs auch zu einem Empfang beim damaligen Staatspräsidenten Ali Abdullah Salih gebeten.
Die Delegation fuhr also zum Präsidenten, und Ali Abdullah Salih wollte Günter Grass eine hohe Auszeichnung, einen Orden, verleihen. Die Begegnung verlief zunächst ganz normal. Man saß unterwürfig im Palast eines allmächtigen orientalischen Herrschers, es roch nach teurem Parfüm, die Anzüge waren vornehm, das Mobiliar erlesen, und überall sah man das wunderbarste Lächeln der Welt.
Verstoß gegen das Protokoll
Doch mittendrin verstieß Günter Grass gegen das Protokoll und zerstach die Blase der Fröhlichkeit und der Allmacht des Despoten. Er erhob die Hand und erklärte, er werde den Orden des Präsidenten nur unter der Bedingung annehmen, dass man den Verfasser dieser Zeilen in sein Land zurückkehren lasse und der Präsident anordne, dass ich nicht mehr juristisch belangt werde.
Die Mannen des Präsidenten im Saal wurden unruhig. Einige behaupteten, der Staat verfolge mich gar nicht, andere sagten, ich sei ein abartiger Betrüger, ich hätte das Land gar nicht verlassen und lebe stattdessen glücklich in meinem Dorf. Wieder andere versuchten Grass davon zu überzeugen, dass der Autor, für den er sich hier einsetze, in Wahrheit kein richtiger Schriftsteller sei und dass sein Buch gar kein echter Roman sei. Sie versuchten alles, um den hohen Gast von seiner Forderung abzubringen.
Eine knappe halbe Stunde lang hörte sich Günter Grass dieses Gefasel an, aber er rückte keinen Deut von seinem Standpunkt ab. Als man ihm dann sagte, ich hätte gegen die edlen Sitten und Traditionen des Jemen verstoßen, wurde er wütend. Er erwiderte, dass man ihm früher so etwas auch vorgeworfen habe, und er sei sich sicher, dass solche Anschuldigungen Unfug seien.

Grass wusste natürlich, dass der Hass gegen mich politisch begründet war, auch wenn die Herrschenden das zu verschleiern versuchten und irgendwelche anderen Gründe vorschoben. Er hatte zu Beginn seiner literarischen Karriere selbst erlebt, dass man ihn zum Vaterlandsverräter erklärte, nur weil er ein Linker war.
Schließlich erbat der Präsident zehn Minuten Zeit, um sich zu beraten. Niemand weiß, was dann tatsächlich passierte, denn Salih nahm keinen seiner Adlaten mit, als er den Raum verließ. Jedenfalls kam er irgendwann zurück und gab bekannt, er wolle der Bitte des Gastes stattgeben. Nun nahm Grass den Orden an.
Die jemenitische und arabische Presse berichtete ausführlich über diese denkwürdige Begegnung zwischen Grass und Salih. Unter anderem soll Grass zum Präsidenten gesagt haben: "Wenn ich Rechtsanwalt wäre und Arabisch könnte, würde ich Wajdi al-Ahdal vor Gericht verteidigen."
Dies belegt, wie heftig die Debatte war, die sich im Präsidentenpalast von Sanaa entsponnen hatte. Ein jemenitischer Freund von mir, der dabei war, berichtete mir später, wie angespannt die Stimmung gewesen sei. Ihm seien Schauer über den Rücken gelaufen und er habe Angst gehabt, er würde an jenem Abend nicht heil nach Hause kommen.
Ein unschätzbarer Sieg gegen die Tyrannei
Grass hatte wenige Tage zuvor den stellvertretenden Vorsitzenden der Sozialistischen Partei des Jemen, Jarallah Omar, getroffen. Dieser hatte ihn auf meinen Fall aufmerksam gemacht, und Grass hatte sich erboten, sich beim Präsidenten für mich einzusetzen. Jarallah begrüßte die Idee. Grass hielt Wort, und er verhalf dadurch der Literatur und den Schriftstellern nicht nur im Jemen zu einem Sieg, sondern überall auf der Welt, wo Autoren unterdrückt werden.
Überglücklich flog ich von Damaskus nach Sanaa zurück, und tausend Sonnen der Hoffnung schienen in meinem Herzen. Wir jemenitischen Schriftsteller hatten einen unschätzbaren Sieg gegen die Tyrannei errungen. Der Verlag durfte wieder aufmachen, meine mitangeklagten Freunde wurden freigelassen, und im Schriftstellerverband feierten wir eine Party für die Freiheit des Wortes.
Unsere Freude währte jedoch kaum zwei Wochen lang. Ende Dezember 2002 ermordete in Sanaa ein radikaler Islamist den Sozialisten Jarallah Omar. Nicht nur ich war traurig über diesen schrecklichen Verlust, sondern auch viele tausend andere Jemeniten. Aber ich spürte wohl mehr als jeder andere, dass der Parteichef auch dafür ermordet worden war, dass er mir das Leben gerettet hatte.
Wajdi al-Ahdal
© Qantara.de 2016
Aus dem Arabischen von Günther Orth
