Eifersucht und Euphorie

Slimane, Werftarbeiter im südfranzösischen Sète, erhält aus heiterem Himmel seine Kündigung. Er ist zu alt, es gibt keine Arbeit mehr: Schluss, Aus. Doch statt aufzugeben, beschließt der 61jährige gemeinsam mit Stieftochter Rym einen Neuanfang, einen alten Kahn wollen sie als Restaurant ausbauen, um den Franzosen eine rare Spezialität anzubieten: Couscous mit Fisch.
Es beginnt ein Marathonlauf durch die Institutionen, an dem Slimanes erweiterte Großfamilie teilhat: die alten Kumpels, die missgünstigen Söhne Madjid und Hamid, die skeptische Geliebte Latifa. Und Slimanes ehemalige Frau soll den Couscous zubereiten.
Damit liegt eine ganze Palette filmischer Emotionen in südländischer Übersteigerung vor: von Enthusiasmus und Euphorie bis hin zu Eifersucht und Pessimismus teilt die Familie alles, um die alte Rostlaube in ein Feinschmeckerlokal umzuwandeln.
Auf den Filmfestivals erweckte dieser Familienstreifen Aufsehen, erhielt gleich mehrere Preise. Doch "Couscous" ist mehr als nur ein weiteres "Multikulti-Drama".
Französisches Bollywood
"Couscous mit Fisch" könnte man ohne viel Federlesens als Sozialdrama erzählen: über einen plötzlich am gesellschaftlichen Rand lebenden Maghrebiner, dessen Traum von der Existenzgründung an der französischen Bürokratie scheitert. Dass Kechiche solche Klischees zwar anreißt, aber nicht ausreizt, liegt an vielem:
Zunächst einmal nimmt er seine Figuren ernst, statt sie zu Marionetten einer Botschaft zu machen. Andererseits haben alle in ihrer Misere einfach viel Spaß: beim Singen, Tanzen und Kochen, beim Klatschen, Diskutieren, Streiten.
"Couscous" ist ein ganz und gar sinnliches Erlebnis – ohne üppiges Dekor, Studio-Scheinwerfer und Orchester. Außerdem vermittelt Kechiche die Einsicht, dass das Leben komplexer ist als alle filmische Dramaturgie:
Über einer Länge von fast drei Stunden fährt "Couscous" genug Nebenhandlungen für ein ganzes Bollywood-Drama auf. Und wie im richtigen Leben versanden manche Konflikte unterwegs, wie der hysterische Anfall von Slimanes überforderter Tochter.
Aus dieser Fülle gestaltet Kechiche Szenen von einer schauspielerischen Intensität und Direktheit, wie man sie allenfalls vom Theater erwartet. Dennoch ist und bleibt der Filmemacher - der als Theaterregisseur anfing - dem Kino, dem filmischen Erzählen verpflichtet, mit Nahaufnahmen und Handkamera und harten Schnitten zieht er den Zuschauer förmlich mitten hinein in diese Familienbande.
Preisverdächtige Experimente
Wenn Rym ihre verstockte Mutter doch noch zur Eröffnung des Restaurants locken will, sind die zehn Minuten, die diese Szene dauert, immer noch zu kurz, um alle in ihr schlummernden Nuancen auszuspielen.
Wegen seines Beitrages zur europäischen Integration erhielt Abdel Kechiche gemeinsam mit Fatih Akin den Europäischen Medienpreis, die Karlsmedaille.
Tatsächlich sind Vergleiche mit dem deutsch-türkischen Ausnahmeregisseur erlaubt. Ganz ähnlich wie der 33-jährige Hamburger schöpft auch der 1960 geborene Kechiche in seinen Filmen immer wieder aus dem unmittelbaren Erfahrungshorizont: die eigenen migrantischen Ursprünge, die tunesischstämmige Familie, die südfranzösische Küste, wohin seine Familie 1966 übersiedelte.
Doch während Akin meist von Genrevorbildern – Gangsterfilm, Roadmovie, Melodrama ausgeht, und seine Filme ihre Kraft aus der Spannung zwischen der sozialen Realität und den Erzählvorgaben des Kinos beziehen, pflegt Kechiche einen radikal experimentellen Ansatz.
Das ist mutig, weil im "Arthausbereich" Kino- und Fernsehauswertung zunehmend ineinander verzahnt sind, und gerade bei Migrationsthemen die Umsetzung bewährter Vorgaben erwartet wird: türmende Töchter, orientierungslose Ghettokids oder alberne Dönerwitzbolde.
Ghetto und Gedicht
Bereits sein Erstling, die Einwanderergeschichte "Le Faute a Voltaire" (2000) zeigte Asylbewerber nicht als Leidenskollektiv, sondern als ebenso freche wie freie Individuen. Der über zwei Stunden lange Film offenbarte allerdings auch die Risiken eines unkonventionellen filmischen Ansatzes: Vor lauter Improvisation entglitt dem Regisseur bisweilen die Kontrolle über Darsteller und Drehbuch.
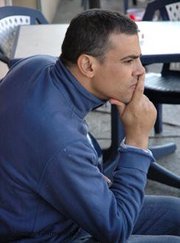
"L'Esquive", der Folgefilm (2003) hingegen erhielt zu Recht vier Cesar-Auszeichnungen, unter anderem für Film und Script: Jugendliche der Banlieus probten da gemeinsam ein Theaterstück von Mariveaux. Dabei springen die wechselnden Liaisons und Eifersüchteleien auf die Realität über, und diese wirkte zurück auf die Proben.
Damit hatte Kechiche sein Prinzip gefunden - die Verknüpfung von Ghetto und Gedicht, von Alltag und Kunst: der arabische Franzose sucht im Milieu immer das individuelle Schicksal, die Nestwärme der Nachbarschaft, die Poesie des Augenblicks.
Das alles erinnert an den alten italienischen Neorealismus, und ist zugleich zukunftsweisend. In "L'Esquive" haben die französischen Kids mit "Inchallah" und "Wallah" den Jargon ihrer arabischen Freunde übernommen. Damit zeichnet sich ein ganz eigener neuer Umgang mit migrantischen Realitäten ab. Couscous für alle eben.
Amin Farzanefar
© Qantara.de 2008
