"Ich muss die Stimme der Gerechtigkeit sein"

Herr Bitar, Sie sind Künstler, haben einen Vollzeitjob und sind Aktivist. Was treibt Sie an?
Farid Bitar: Ich habe einen Vollzeitjob als Fallmanager. Ich kümmere mich um AIDS-Kranke. Den Rest meiner Zeit widme ich verschiedenen Aktivitäten: Poesie, Performance, Ton-Aufnahmen. Ich male und erstelle Holzschnitzereien. Für mich ist das Ganze eine Art künstlerischer "Dreisatz": Ein Gemälde entsteht aus einem Gedicht, ein Gedicht wird zu einer Holzschnitzerei und eine Holzschnitzerei entsteht letztlich aus einem Blatt Papier. Ich frage mich immer nach dem Sinn meines Lebens. Ich kann weder New York ändern noch Palästina. Ich sage mir, ich muss entweder die Stimme der Vernunft oder die der Gerechtigkeit sein.
Woher kommt Ihre Familie? Sind Sie jemals zurückgekehrt?
Bitar: Meine Eltern kamen aus Jerusalem. Ich bin ein stolz darauf, ein Bürger Jerusalems zu sein. Das kann mir niemand nehmen. Ich bin in Jerusalem geboren und stamme aus dieser Stadt. Dort will ich eines Tages auch wieder zurück. Bis 1967 hielt ich mich dort auf. Damals war ich sechs Jahre alt. Meine letzte Reise nach Jerusalem unternahm ich 2007, als meine Mutter im Sterben lag. Ich besuchte sie zunächst in einer Siedlung, dann in einem Krankenhaus und zuletzt in einem Pflegeheim, was mir gar nicht gefallen hat. Ich habe vier Gedichte über meine Erfahrungen dort geschrieben. Einen Monat nach meiner Abreise verstarb sie. Das war meine bisher letzte Reise dorthin. Wer weiß, ob ich je zurückkehren werde. Doch meine Gedichte sind überall. Meine Stimme ist überall. Ich will das so.
Sie waren 2009 auf dem Gaza Freedom March…
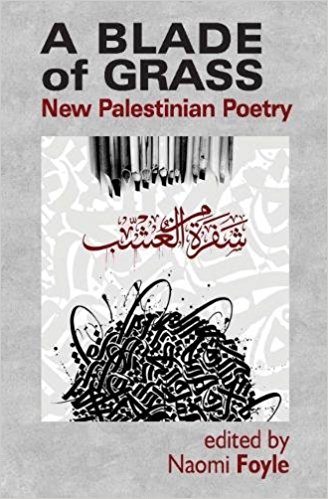
Bitar: …Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee dazu hatte. Aber nachdem wir festgestellt hatten, wie viele Menschen in Gaza gestorben waren (etwa 1.470 Personen), reiste fast die gleiche Anzahl aus 43 Ländern unter dem Banner des Gaza Freedom March nach Kairo. Ich wollte ein Teil hiervon sein. Ich war einer der 60 Leute, die hinein durften. Das war ein sehr erhebender Moment. 48 Stunden lang war ich in Gaza. Traurig war, dass die gesammelten Hilfslieferungen zwar durchkamen, aber sie wurden von der Hamas konfisziert.
Welche Person hat Sie besonders inspiriert?
Bitar: Aus Che Guevara ziehe ich meine revolutionäre Inspiration und aus Mahmoud Darwish meine poetische. Darwish war vielleicht nur 20 Jahre älter als ich, aber er ist bis heute die Stimme in meinem Hinterkopf geblieben. Und dann ist da noch Fadwa Tuqan. Sie ist noch stärker, obwohl niemand wirklich von ihrer eindrucksvollen Persönlichkeit gehört hat. Darwish, zum Beispiel, wäre derjenige gewesen, der zu ihren Füßen gesessen und ihr zugehört hätte.
Was würde Ihrer Meinung nach die Position der Palästinenser im gegenwärtigen Konflikt stärken? Und ist es möglich, dass sich Menschen versöhnen, obgleich sie sich seit Langem nicht einigen können?
Bitar: Mir geht es gut, vielen anderen Palästinensern dagegen nicht. Manchmal raubt mir das den Schlaf. Meist stehe ich um drei oder vier Uhr morgens auf, male und denke. Ich laufe herum wie ein Zombie – Schlaftabletten wirken da nicht. Dennoch gehe ich am nächsten Morgen an die Arbeit. Und aus diesem Empfinden schreibe ich meine Gedichte, manchmal wie aus einem dunklen Raum heraus.
Ich habe Visionen, kann sie aber nicht genau bestimmen. Meine Gedichte sind fast durchweg den Toten gewidmet, nicht den Lebenden. In meiner Kunst tauchen immer wieder vier Wörter auf: al-'ouda [Rückkehr], Filasteen [Palästina], Nakbah [palästinensischer Exodus oder Katastrophe] und al Quds [Jerusalem]. Sie wiederholen sich, weil wir brennen. Doch man wird uns nicht auslöschen können.
Auf welche Momente in Ihrer Karriere als Dichter sind Sie besonders stolz?
Bitar: Auf die Aufführung meines Gedichtes "Nakba" vor dem Rathaus von New York und dem Bürgermeister. Ich habe das Gedicht aus dem Gedächtnis rezitiert, sowohl in arabischer als auch in englischer Sprache. Dabei trug ich eine Harley-Davidson-Jacke und meine Kufiyah, das arabische Kopftuch. Ich trat auch vor zweitausend Zuschauern zum 48. Jahrestag der Nakba, der Vertreibung der Palästinenser, auf. Einige meiner Gedichte wurden auch im Radio vorgetragen – z.B. "Oh Jericho" und "Bauha" wurden vom Sender Columbia University QXR ausgestrahlt. Einer Radiomoderatorin gefiel besonders "Bauha". Sie hat es immer wieder für die Zuhörer auf Podcasts übertragen. "Farid", sagte sie, "Wenn wir dich aus diesem Gedicht herausnehmen und durch ein anderes Kind in Kambodscha, in Afghanistan oder im Irak ersetzen, bleibt es das gleiche Gedicht. Ein Kind im Krieg."
Bei der Londoner Lesung der Gedichte zur Vorstellung von "A Blade of Grass" fügten Sie einige Zeilen hinzu, die nicht im Buch stehen.
Bitar: Ich bin Performance-Künstler. Das kann dann schon mal passieren. Papier schränkt manchmal die künstlerische Freiheit ein. Aus einem Buch bloß einige Zeilen abzulesen macht die Intensität bisweilen doch zunichte. Und es ist schließlich mein Gedicht, mein Eigentum und ich habe das Recht, aus dem Fenster oder durch die Tür herauszutreten. Das ist absolut menschlich. Es geht auch nicht darum, im Mittelpunkt zu stehen, sondern darum, die Tiefe eines Gedichtes mit dem Publikum zu teilen. Das ist ein einzigartiges Erlebnis.
Bevorzugen Sie eine bestimmte Sprache in Ihrer Poesie?
Bitar: Neunzig Prozent von dem, was ich schreibe, schreibe ich wegen meiner Jahre in den USA auf Englisch. Doch ich bin stolz darauf, zu meinen eigenen sprachlichen Wurzeln zurückzukehren. Wenn ich ein Gedicht auf Arabisch verfasse, lasse ich es so, wie es ist. Manchmal werden Gedichte leider durch Übersetzungen ruiniert.
Übersetzen Sie Ihre Gedichte daher immer selbst?
Bitar: Ja, denn niemand anders könnte das fühlen, was ich fühle. Wie schon Darwish und Fadwa Tuqan und Pablo Neruda gesagt haben: Ein Gedicht verliert 20 bis 30 Prozent seiner Bedeutung, wenn es übersetzt wird. Also übersetze ich meine Gedichte lieber selbst.
Das Interview führte Valentina Viene.
© Qantara.de 2018
Aus dem Englischen von Peter Lammers
