Der Koran – jetzt auch auf Samoanisch und Shona

Im muslimischen Jahr 1422 (2002) feierte der „König-Fahd-Komplex für den Druck des Korans“ in Medina, Saudi-Arabien, die Veröffentlichung der allerersten (Teil-)Übersetzung des Korans in Romanes. Das ist die Sprache der Rom*nja, der wohl am stärksten marginalisierten Volksgruppe in Europa.
Der Übersetzer, Muharem Serbezovski, ist eine schillernde Figur, von der nicht unbedingt eine Zusammenarbeit mit dem saudischen religiösen Establishment zu erwarten war. Serbezovski stammt aus Skopje, der damaligen Hauptstadt der jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien – ein Zentrum der muslimischen Rom*nja.
Als erfolgreicher Popsänger hatte er das jugoslawische Publikum mit Hits wie „Ich bin ein Z*** und ich weiß, wie man liebt“ („Ciganin sam i umem da volim“) begeistert. In den 1980er Jahren begann er, Erzählungen und Gedichte zu schreiben. Durch die Schaffung einer eigenen Literatur wollte er den Status des Romanes aufwerten – einer hauptsächlich mündlich verwendeten Sprache, der wenig Prestige zukommt.
Sein Sprachaktivismus kulminierte in der prestigeträchtigsten Form von Literatur überhaupt: der Übersetzung einer heiligen Schrift. Dies passte dem saudischen König-Fahd-Komplex, der von seinen Koranübersetzern normalerweise einen solideren religiösen Hintergrund erwartet, gut ins Konzept.
Die saudische Institution, die sich seit 1989 dem Druck von Koranübersetzungen in Dutzende von Sprachen widmet, ist äußerst bestrebt, ihr Portfolio zu erweitern. Besonders gern gesehen sind Sprachen, in die der Koran noch nie übersetzt worden ist. Ergibt sich eine gute Gelegenheit, ist der Komplex durchaus zu Kompromissen bereit, solange der Übersetzer nur Muslim ist.
Win-Win-Situation für Übersetzer und Finanziers
Romanes wird von etwa 3,5 Millionen Menschen in etlichen Ländern Europas in unterschiedlichen Varianten gesprochen, aber nur wenige von ihnen sind praktizierende Muslim:innen. Hinzu kommt, dass es nicht allen leichtfällt, die von Serbezovski verwendete Balkan-Variante des Romanes zu verstehen.
Außerdem lesen und schreiben gebildete Rom*nja normalerweise in der Mehrheitssprache des Landes oder der Region, in der sie leben – zum Beispiel auf Bosnisch, Albanisch oder Tschechisch. Es gibt nahezu niemanden, der auf eine Romanes-Koranübersetzung angewiesen ist, um die Bedeutung des Korans zu verstehen.
Dass der König-Fahd-Komplex dennoch mit Serbezovski das Projekt der Romanes-Übersetzung verfolgt hat, zeigt deutlich: Koranübersetzungen in Minderheitensprachen dienen vor allem der Sprachpolitik. Unabhängig von ihrem Nutzwert haben sie eine symbolische Funktion. Sie verkörpern das Engagement des Verlegers für die Verbreitung des Islams und helfen Sprachaktivist:innen, das Prestige ihrer Sprachen zu steigern und zu deren Standardisierung beizutragen.

Minderheitensprachen als Kulturgut
Saudi-Arabien ist nicht der einzige Staat, der in diese Art von Aktivitäten investiert hat. So war etwa die libysche World Islamic Call Society in den 2000er Jahren für die ersten Koranübersetzungen in Sprachen wie Wolof und Maltesisch verantwortlich.
In den letzten zehn Jahren ist vor allem das türkische Direktorat für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) weltweit aktiv, unter anderem in Afrika, wo es brandneue Zielsprachen wie Chewa und Shona erschließt.
Mittlerweile hat das Diyanet-Projekt „Hediyen Kur’an olsun!“ („Möge mein Geschenk ein Koran sein!“) 42 Sprachen im Portfolio, darunter Samoanisch, die Sprache des Inselstaats Samoa östlich von Australien, in dem zum Zeitpunkt der letzten Volkszählung 2001 ganze 48 Muslim:innen lebten.

Wie die Muttersprache unser Gehirn formt
Sprache entsteht in verschiedenen Regionen unseres Gehirns. Forscher konnten zeigen, dass diese je nach Muttersprache anders verknüpft sind. Das Wissen lässt sich etwa nutzen, um Schlaganfall-Patienten zu helfen.
All dies geschieht auch, weil sich der Status von Minderheitensprachen in den letzten Jahrzehnten weltweit gewandelt hat: Von einem Störfaktor sind sie zu einem erhaltenswerten Kulturgut geworden.
1998 ist die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Kraft getreten, und momentan befinden wir uns in der ersten Hälfte der von der UNESCO für 2022 bis 2032 ausgerufenen Internationalen Dekade der indigenen Sprachen.
Ein Beispiel für diesen Wandel ist Indonesien. Dort war es gelungen, die Kolonialsprache Niederländisch sowie eine Vielzahl lokaler und regionaler Sprachen in allen Bereichen des Bildungswesens, den Medien und der offiziellen Kommunikation durch eine einzige Landessprache zu ersetzen.
In den 1960er Jahren hatte die indonesische Regierung auch eine autoritative Koranübersetzung herausgegeben, die eine tragende Rolle dabei spielte, die indonesische Sprache selbst unter konservativen Religionsgelehrten zu popularisieren.
Diese Strategie funktionierte allerdings so gut, dass heute viele der mehreren hundert Sprachen, die in Indonesien gesprochen werden, vom Aussterben bedroht sind. Die Dominanz des Indonesischen ist so erdrückend, dass die Regierung es sich nun leisten kann, linguistische Vielfalt zu zelebrieren.
2011 begann das indonesische Ministerium für religiöse Angelegenheiten, Koranübersetzungen in mehr als zwei Dutzend sogenannter „Regionalsprachen“ zu produzieren: Makassar und Palembang, Tolaki und Mandar, Ternate und Bima. Allerdings haben diese Sprachen nur noch wenige bis gar keine Leser:innen, was dem Ministerium wohlbekannt ist. Einige der Übersetzungen hatten eine Auflage von gerade einmal 70 Exemplaren.
Kaum Übersetzungen in keltische Sprachen
Im europäischen Kontext gibt es ähnliche Tendenzen. Die keltischen Sprachen zum Beispiel galten vor hundert Jahren als Idiome ungebildeter Bauern. Wer sozial aufsteigen wollte, sprach Englisch statt Walisisch, oder Schottisch, Irisch und Französisch statt Bretonisch. Heute hat sich das Image der keltischen Sprachen gewandelt. Sie stehen für eine Jahrtausende alte Geschichte, eine reiche Mythologie und eine tiefe Verwurzelung in ihren Regionen.
Bemühungen, sie zu Sprachen des Islam zu machen, gestalten sich allerdings zäh. Seit Anfang der 2000er Jahre kündigen muslimische Aktivist:innen, lokale muslimische Gemeinschaften und sogar das Institut Foras na Gaeilge, das für die Förderung der irischen Sprache in der Republik Irland und in Nordirland zuständig ist, immer wieder Projekte an, um den Koran in eine der keltischen Sprachen zu übersetzen.
Doch keine dieser Ankündigungen hat bisher zu greifbaren Ergebnissen geführt. Es gibt zu wenige Muslim:innen, die diese Sprachen sprechen, weswegen die Projekte immer wieder daran scheitern, passende Übersetzer:innen zu finden. Die keltischen Sprachen mögen zwar ein hohes Prestige haben, aber der Wunsch, sie für sich zu reklamieren, ist in muslimischen Gemeinschaften zu schwach ausgeprägt.
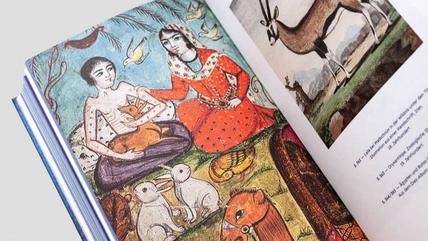
„Das kulturelle Gedächtnis der Araber”
Der Arabist Stefan Weidner hat vorislamische Gedichte gesammelt und ins Deutsche übersetzt. „Der arabische Diwan” gibt faszinierende Einblicke in jahrhundertealte Werke, die in der arabischen Welt heute noch zum Kanon zählen.
Übersetzungsprojekte sind häufiger von Erfolg gekrönt, wenn es sich um Minderheitensprachen handelt, die in mehrheitlich muslimischen Kontexten gesprochen werden. Zum Beispiel liegen heute mindestens vier Übersetzungen des Korans ins Tamazight vor, der Sprache der nordafrikanischen Amazighen, früher „Berber“ genannt.
Wie die keltischen Sprachen wurde auch das Tamazight lange Zeit marginalisiert oder sogar unterdrückt, insbesondere in Algerien. In den 1970er und 1980er Jahren formierte sich jedoch eine kulturelle Widerstandsbewegung der Amazighen, aus der in den 1990er und 2010er Jahren die ersten Tamazight-Koranübersetzungen hervorgingen.
Auch der saudische König-Fahd-Komplex gab in Zusammenarbeit mit dem algerischen Ministerium für religiöse Angelegenheiten eine Tamazight-Koranübersetzung heraus. Diese zog jedoch heftige Kritik auf sich, weil sich der Autor, Si Muhand Tayyib, von der Agenda der Tamazight-Sprachaktivist:innen distanzierte.
Diese schreiben Tamazight in lateinischer Schrift oder sogar in Neo-Tifinagh, einem aus der Tuareg-Schrift entwickelten Alphabet. Sie verwenden – oder konstruieren – ein puristisches Vokabular mit möglichst geringen Einflüssen aus dem Arabischen. Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind jedoch für durchschnittliche Tamazight-Sprecher kaum zu verstehen.
Si Muhand Ṭayyib ignorierte die Forderungen der Amazigh-Aktivist:innen bewusst, schrieb Tamazight in arabischer Schrift und verwendete bedenkenlos geläufige arabische Lehnwörter. Seine Übersetzung war damit die Einzige, die eine Chance hatte, zumindest eine begrenzte Leser:innenschaft zu erreichen.
Koranübersetzungen retten Sprachen
Koranübersetzungen in Minderheitensprachen befinden sich im Kreuzfeuer der Auseinandersetzung zwischen zwei Arten von Aktivismus: Die einen setzen sich für die Sprache ein, die anderen wollen den Islam verbreiten. Nicht immer muss dies jedoch zu einem Konflikt führen.
So arbeitet beispielsweise der Dakwah Corner Bookstore (DCB), ein mehrsprachiger Missionsverlag aus Malaysia, derzeit an einem ehrgeizigen Projekt zur Erstellung einer Koranübersetzung ins Rohingya, die Sprache einer muslimischen Minderheit aus Myanmar, die massiver Verfolgung ausgesetzt ist.
Auch wenn das Hauptziel von DCB die Verbreitung des Islam ist, hat das Unternehmen beträchtliche Ressourcen für die Entwicklung einer Übersetzungsmethode für eine Sprache aufgewendet, die aufgrund ihrer Geschichte der Unterdrückung über keine literarische Tradition, kein ausgefeiltes Wörterbuch und keine Werkzeuge für digitales Schreiben und Schriftsatz verfügt. Koranübersetzungen leisten einen Beitrag dazu, Sprachen vor dem Aussterben zu bewahren oder ihnen sogar zu neuer Blüte zu verhelfen.
© Qantara.de
