Algerien ringt mit dem kolonialen Erbe

In einem entlegenen Ort im Süden Algeriens, wo der Sommer sechs Monate dauert, begegnen wir einer jungen Frau und ihrem Vater. Oberflächlich betrachtet ist die Beziehung der beiden solide. Doch ich Laufe der Geschichte kommt immer mehr zu Tage, wie angespannt sie ist, besonders nachdem die junge Frau beschuldigt wird, ihren Ehemann getötet zu haben.
Mit dieser Krimi-Erzählung startet der Roman „Gegen den Strom”. Darin zeichnet Saïd Khatibi ein tiefgründiges Porträt der algerischen Gesellschaft, die noch immer durch ihre Erinnerung an Gewalt und Gegengewalt geprägt ist.
Auf 288 Seiten beschreibt der Roman den Wandel der algerischen Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Befreiungskrieg gegen den französischen Kolonialismus (1954-62) sowie dessen Folgen. Er wurde diesen Monat von Hachette Antoine unter dem Titel „أغالب مجرى النّهر“ in Beirut veröffentlicht und soll auch ins Englische übersetzt.
Trotz der Versuche, sich vom Erbe ihrer Vorfahren zu befreien, zieht die Geschichte die Figuren wie in der Strömung eines Flusses in ein Schicksal, das ihren Träumen und Wünschen widerspricht. Der Roman blickt auf die Beziehung von Eltern und Kindern, beide Erzählperspektiven bekommen Raum.
Die Perspektive des Vaters Azouz repräsentiert die Widersprüche, die Vaterschaft in postkolonialen Gesellschaften prägt. Auf ihm liegt die Last einer schmerzhaften Geschichte, die er nicht loswerden kann. Er wird von kiyya heimgesucht – einem Brandzeichen auf seinem Rücken, das diejenigen kennzeichnet, denen Kollaboration mit den Kolonialherren vorgeworfen wurde.
Die Stigmatisierung trifft nicht nur den Vater, sondern auch seine Tochter Aqila und seinen Sohn Miloud. Die Vaterschaft wird von Scham begleitet und verliert die symbolische Autorität, die das traditionelle patriarchalische System normalerweise gewährt. Der Roman stellt die Frage, ob der Vater seine Identität vor dem Zerbrechen bewahren kann oder ob er – wie seine Kinder – ein Opfer des unausweichlichen kolonialen Erbes ist.

Traditionen dominieren familiäre Beziehungen
Der Roman beschreibt die algerische Gesellschaft nach der Unabhängigkeit als einen psychologisch belasteten Raum, gefangen zwischen der Dominanz der Tradition und dem Wunsch nach Unabhängigkeit. Strenge gesellschaftliche Traditionen schränken die Freiheit der Individuen und ihre Entscheidungsmöglichkeiten ein. Diese Zerrissenheit äußert sich in einer extremen Ehrfurcht vor der elterlichen Autorität, die dadurch weder in Frage gestellt noch überwunden wird.
Dieser absolute Gehorsam entsteht aus Angst vor Konfrontation oder den Folgen von Rebellion. Er macht die Kinder zu Gefangenen des kolonial geprägten elterlichen Erbes und zermürbt die familiären Bindungen. So verleugnet Miloud aus Angst vor der Reaktion seiner Eltern seine uneheliche Tochter und überlässt sie einem tragischen Schicksal.
Diese Tragödie wiederholt das Leid seines Vaters Azouz, der sich seinerzeit ebenfalls der Verantwortung für ein uneheliches Kind entzog. Azouz bringt diese angespannte Beziehung mit den Worten zum Ausdruck: „Niemand kennt seine Kinder wirklich“, was die Isolation widerspiegelt, die Kinder in ihren Familien erfahren.
Seine Tochter Aqila, eine Augenärztin, gerät zwischen die Fronten zweier gesellschaftlicher Autoritäten: Einerseits die Autorität ihrer Mutter Qamra, die ihre eigene patriarchale Erziehung weitergibt, und andererseits die Autorität ihres Mannes Makhlouf Toumi, eines Gerichtsmediziners, der ihr körperliche und symbolische Gewalt antut.
Aqila reflektiert die Erfahrungen mit ihrer Mutter und Schwiegermutter und erklärt: „Mütter behandeln ihre Kinder wie Kriegsbeute. Sie wollen, dass sie unterwürfig sind und nichts in Frage stellen.“ Durch die Figur Aqila wirft der Autor eine philosophische Frage auf, die in zeitgenössischen Romanen nur selten angesprochen wird: Sind der Wunsch nach und die Praxis der Mutterschaft angeboren, oder werden sie gesellschaftlich erworben?

Entschleiert euch!
Bereits vor über hundert Jahren wurde argumentiert, das Kopftuch stehe für männliche Unterdrückung, was unvereinbar mit der westlichen Zivilisation und Werteordnung sei. In Frankreichs Kolonien ließ man daher auf Worte Taten folgen und zwang Musliminnen dazu, die Verschleierung abzulegen. Historische Einblicke von Susanne Kaiser
Aqila sagt über die Beziehung zu ihrer eigenen Tochter: „Ich bin mir noch nicht im Klaren darüber, ob ich sie [meine Tochter] liebe oder ob ich einfach nur instinktiv die Mutterschaft ausübe. Und doch habe ich als Kind davon geträumt, eine Mutter zu sein“.
Zudem spricht der Autor die Macht des Patriarchats in gebildeten Kreisen Algeriens an. Die Figur von Aqilas Ehemann, dem Arzt Makhlouf Toumi, unterscheidet sich in dessen Festhalten am traditionellen Modell der Vaterschaft nicht vom Rest der Gesellschaft.
Wie Aqila erzählt: „Er wünschte sich einen Jungen, aber ich habe ein Mädchen geboren, also machte er mich zu seiner Feindin. Er weiß, dass der Mann das Geschlecht des Babys bestimmt, aber er leugnet es vor sich selbst. Nach der Geburt habe ich ihn gefragt, wie er unsere Tochter nennen möchte, und er meinte: ‚Eine Ehe, aus der kein Junge hervorgeht, ist Zeitverschwendung‘.“
Die Rolle der Frauen im Unabhängigkeitskrieg
Der Intellektuelle Franz Fanon und eine Vielzahl berühmter Intellektueller haben die psychologischen und sozialen Veränderungen diskutiert, die die algerische Gesellschaft nach der Befreiungsrevolution erlebt hat. Unter anderem die Rolle der Frau in dieser entscheidenden Zeit. Sie beleuchteten vor allem das Leid der Frauen, die ihre Ehemänner verloren und ihre Kinder allein großziehen mussten, was zu einer Verlagerung der gesellschaftlichen Beziehung zwischen den Geschlechtern beigetragen hat.
Khatibis Roman zeigt jedoch, dass die Geschlechterrollen heute weitgehend unverändert erhalten sind. Zu dieser Langlebigkeit tragen ein mangelndes Bewusstsein für die die Geschlechterbeziehungen innerhalb der Familien sowie der Einfluss extremistischer religiöser Strömungen in einigen Teilen der Gesellschaft bei. Diese Dynamik führt zu zerrütteten Familien und einer Zunahme von Gewalt und Diskriminierung von Frauen.
Die Rolle der Frau im Unabhängigkeitskrieg bringt Khatibi ebenfalls zur Sprache, zum Beispiel durch den Charakter Qamra Dili, die die Widerstandskämpfer:innen unterstützte, oder Schahla al-Barq, die der Autor wie folgt beschreibt: „Sie führte ihre Operationen blitzschnell durch, stürmte nach vorne und schaute nicht zurück. Sie war eine Widerstandskämpferin im Unabhängigkeitskrieg”.
An dieser Stelle widerspricht die Erzählung zudem gängigen Stereotypen, denen zufolge Männer gewalttätig und Frauen emotional seien. Die Figur der Schahla foltert Algerier:innen, denen die Zusammenarbeit mit Frankreich vorgeworfen wird.
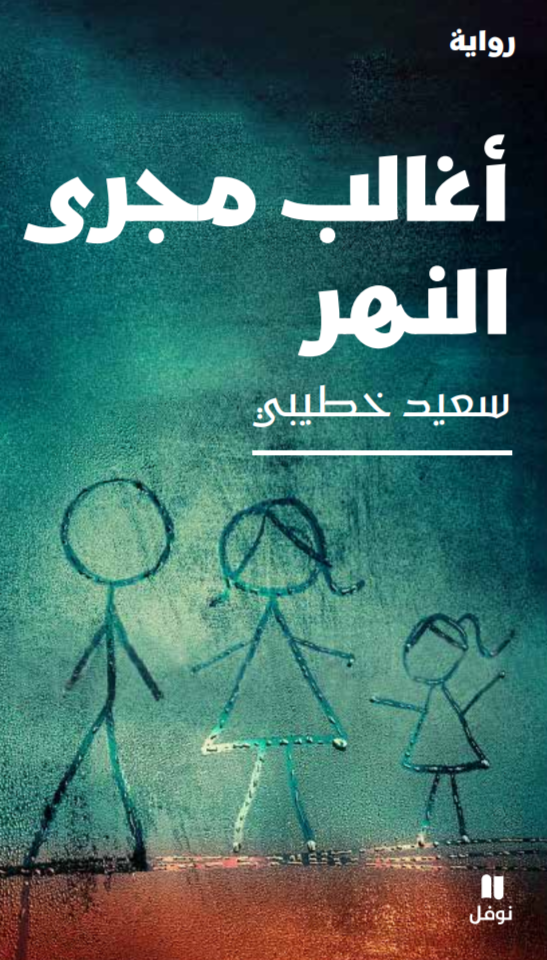
Ein gewaltvolles Erbe
„Gegen den Strom“ nimmt auch Medizin und Religion in den Blick, die im postkolonialen Algerien in einem das Spannungsverhältnis stehen. Sie treffen aufeinander und prägen das kollektive Bewusstsein nach dem Kolonialismus, denn unter der Kolonialherrschaft war ein Arzt nicht nur jemand, der Krankheiten behandelte, sondern auch ein Symbol der Autorität. Nach der Unabhängigkeit hat der Arzt diese Autorität weiterhin inne und gerät gleichzeitig in Konflikt mit der Religion, die nach wie vor eine zentrale Rolle in der algerischen Gesellschaft spielt.
Hier führt der Autor das Beispiel lebensrettender Organspenden an, ein Thema, das in der arabischen Literatur selten besprochen wird. Das mangelnde Bewusstsein für Organspenden in der algerischen Gesellschaft führt zu unethischen Praktiken wie dem Diebstahl von Organen von Verstorbenen. Der Gerichtsmediziner Makhlouf Toumi beauftragt im Roman seine Frau Aqila, Organe aus Leichen zu stehlen, um sich finanziell zu bereichern.
Diese Ausbeutung toter Körper hat eine symbolische Dimension: In einer Gesellschaft, die sich gerade erst von der Kolonialherrschaft mit ihrem Erbe von Gewalt und physischer Ausbeutung befreit hat, wird der Körper zur Ware.
Der Roman ist eine Fortsetzung von Khatibis literarischem Werk, das die Wurzeln und Erscheinungsformen von Unterdrückung und Ausgrenzung in der algerischen Gesellschaft, ob offen oder versteckt, durch packende Erzählungen aufdeckt und kritisiert.
Khatibis Sprache ergänzt die Handlung, indem er mehrere Charaktere, innere Monologe und eine Vielzahl literarischer Genres miteinander verwebt. Die Erzählstruktur basiert auf den Erinnerungen des Vaters und der Tochter, während die anderen Figuren durch kurze Erzählabschnitte aufgerufen werden, die die Abfolge der Ereignisse unterbrechen.
Ohne Kapitelüberschriften, die den Weg weisen, verlangt der Text vom Leser ständige Konzentration, um das Geheimnis des Mordes zu lüften und die sozialen Veränderungen der historischen Epoche zu erfassen. In diesem Werk ist die Geschichte nicht nur eine Kulisse, sondern eine dynamische Kraft, die den Konflikt der Gegenwart durch die Vergangenheit gestaltet und den Leser dazu einlädt, bestehende Wertesysteme und soziale Strukturen zu hinterfragen.
Dieser Artikel ist eine bearbeitete Übersetzung des arabischen Originals. Übersetzung von Leonie Nückell.
© Qantara.de
